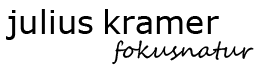Rückkehr eines südlichen Gastes nach Bayern
Noch vor wenigen Jahrzehnten galt es als Sensation, Bienenfresser (Merops apiaster) in Bayern anzutreffen. Die wärmeliebenden Vögel hatten sich lange Zeit nur sporadisch hierher verirrt . Erst ab den 1990er-Jahren begannen sie wieder in kleinen Kolonien in Bayern zu brüten. Vor allem entlang der Donau in Schwaben und Oberbayern – wo warme, offene Landschaften und geeignete Brutplätze verfügbar sind – fassten sie Fuß. Ornithologen führen diese Rückkehr auch auf das milder werdende Klima zurück: Durch den Klimawandel dehnen die Vögel ihr Brutareal aus Südeuropa nach Norden hin aus. Waren um 2005 zunächst nur wenige Dutzend Brutpaare im Freistaat bekannt, so steigt der Bestand seitdem stetig an. Aktuellen Schätzungen zufolge brüten mittlerweile über 200 Paare in Bayern (Stand 2019) – eine Erfolgsgeschichte, die jedoch eng mit dem Fortbestand geeigneter Lebensräume und reichhaltiger Insektenvorkommen verknüpft ist.
Lebensraum an der Donau und Brutbiologie
Bienenfresser besiedeln bevorzugt offene Landschaften mit Wärme und spärlicher Vegetation. In Bayern finden sie solche Bedingungen vor allem entlang von Flusstälern wie der Donau, wo es steile Lehm- und Sandabbrüche gibt. Mangels natürlicher Steilufer weichen die Vögel häufig auf vom Menschen geschaffene Strukturen aus: Brachen wie alte Kies-, Sand- oder Lößgruben werden gerne als Brutplatz gewählt . In senkrechten Abbruchkanten graben die Paare eine Niströhre – einen Tunnel von etwa ein bis zwei Metern Länge – an dessen Ende 4–7 Eier gelegt werden. Die Stellen sind möglichst sonnig und unbewachsen, oft in 2–5 m Höhe, damit Nesträuber (z. B. Füchse) nur schwer hinkommen. Häufig teilen sich Bienenfresser ihre Brutwände mit Uferschwalben, die ähnliche Ansprüche haben.
Als Zugvögel kehren die ersten Bienenfresser meist im Mai aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurück. Mit ihren ratternden Rufen („prüt prüt“) machen sie dann auf sich aufmerksam. Die Brutzeit erstreckt sich von Mitte Mai bis August . In dieser Zeit sind die Altvögel emsig mit Graben, Brüten und Insektenjagd beschäftigt. Ende des Sommers, spätestens im September, treten die Familien den Rückflug gen Süden an. Eine zweite Jahresbrut gibt es nicht, sodass die Vögel pro Jahr nur einen Versuch haben, ihre Jungen großzuziehen.
Nahrung: Jäger der Lüfte
Bienenfresser ernähren sich nahezu ausschließlich von fliegenden Insekten. Ihr deutscher Name kommt nicht von ungefähr: Etwa drei Viertel der Beute bestehen aus Hautflüglern wie Wildbienen, Wespen und Hummeln. Daneben erbeuten sie Käfer, Libellen, Schmetterlinge und andere größere Insekten im Flug. Technik der Jäger: Die Vögel stoßen von einer Warte aus auf Beutetiere herab oder jagen zielsicher in der Luft. Stacheltragende Insekten werden vor dem Verspeisen durch Schlagen auf einen Ast von Stacheln und Gift entleert. Wasserflächen und blütenreiche Auen entlang der Donau begünstigen das Angebot an Insekten und machen die Region attraktiv für die Nahrungssuche. Oft kehren die Tiere zu bestimmten Ansitzen – etwa trockenen Ästen oder Zaunpfählen – zurück, um dort ihre Beute zu verzehren oder dem Partner anzubieten.
Die Spezialisierung auf Großinsekten macht den Bienenfresser empfindlich gegenüber dem Insektenrückgang in unserer Kulturlandschaft. Nur wo genügend Schmetterlinge, Käfer und Wildbienen schwirren, können die bunten Jäger ausreichend Nahrung für sich und ihren Nachwuchs finden. In gewisser Weise gelten sie daher als Indikator für intakte, insektenreiche Lebensräume – ein Aspekt, der in Zeiten allgemeiner Insektenarmut aufmerksam beobachtet wird.
Gefährdung und Schutzstatus
Obwohl der Bestand im Aufwind ist, zählt der Bienenfresser in Bayern weiterhin zu den extrem seltenen Brutvögeln. Entsprechend ist er rechtlich streng geschützt – Störungen an den Nestern sind verboten. Viele der besiedelten Brutplätze sind jedoch kurzlebig: Sand- und Kiesgruben werden verfüllt oder erodieren mit der Zeit, sodass die Steilwände verschwinden. Zudem reagieren Bienenfresser gerade während der Anlage der Brutröhren sehr empfindlich auf Annäherung. Freizeitaktivitäten oder unbedachte Beobachter können dann zum Abbruch der Brut führen. Naturschützer*innen versuchen daher, bekannte Koloniestandorte zu sichern – etwa indem sie in ungenutzten Gruben das Abrutschen von Material verhindern, das sonst Räubern als Rampe dienen könnte. Auch werden Beobachtungsorte oft geheim gehalten, um die Störenfriede fernzuhalten. Dank solcher Maßnahmen und der fortschreitenden Klimaerwärmung stehen die Chancen gut, dass der Bienenfresser sich entlang der Donau weiter etablieren kann. Jede neue Kolonie ist ein Gewinn für Bayerns Vogelvielfalt – und ein beeindruckendes Schauspiel in unseren Auenlandschaften.
Fotografische Herausforderungen und Tipps
Naturfotograf*innen schätzen den Bienenfresser als dankbares, wenn auch anspruchsvolles Motiv. Damit die Aufnahme gelingt und die Tiere nicht gestört werden, sind einige Hinweise zu beachten:
Geduld und Abstand: Bienenfresser sind wachsam und flüchten bei Annäherung schnell. Fotografieren lässt sich die Art am besten aus großer Distanz mit Teleobjektiv. Ein Tarnzelt oder das Verstecken im Gebüsch in den frühen Morgenstunden kann helfen, ohne Beunruhigung der Vögel auszukommen. Eine Störung der Tiere ist unbedingt zu vermeiden und streng verboten! Das heißt: Das Tarnzelt vor Sonnenaufgang aufstellen, wenn die Tiere schlafen, und erst wieder herauskommen und abbauen, wenn es dunkel geworden ist. Wichtig: Einen Mindestabstand (ca. 100–200 m) zu Brutwänden sollten ungetarnte Beobachter*innen unbedingt einhalten.
Hitze und Licht: An sonnigen Tagen flimmert die Luft über den aufgeheizten Kiesböden – ein Problem für scharfe Fotos. Daher empfiehlt es sich, in den kühleren Morgen- oder Abendstunden zu fotografieren, wenn das Licht weicher ist und die Vögel zudem aktiv jagen. So entstehen brillantere Aufnahmen ohne Hitzeschleier.
Verhalten nutzen: Bienenfresser kehren oft zu bestimmten Lieblingszweigen oder Zaunpfählen zurück, die als Ansitz dienen. Solche Routinen können Fotografierende ausnutzen: Ist ein häufig genutzter Ast bekannt, lässt sich Kamera und Fokus im Voraus ausrichten. Mit etwas Glück landet der Vogel genau dort mit einem Insekt im Schnabel – ein perfekter Moment, um auf den Auslöser zu drücken.
Fazit: Die Rückkehr des Bienenfressers an die bayerische Donau ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie flexibel und widerstandsfähig die Natur sein kann. Für Naturfreundinnen und Fotografinnen bietet dieser farbenfrohe Vogel einzigartige Beobachtungen – von akrobatischen Beuteflügen bis zum geselligen Treiben in der Kolonie. Gleichzeitig erinnert sein Wiederauftauchen daran, wie wichtig der Erhalt von Lebensräumen und Insektenvielfalt ist, damit Exoten wie der Bienenfresser dauerhaft bei uns heimisch werden.